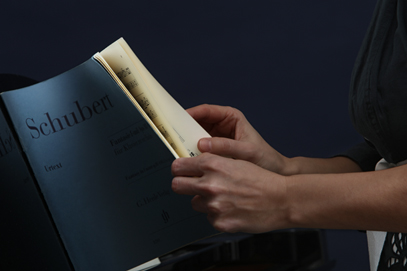
Klavier Notizen
Auf dieser Seite möchte ich in lockerer Folge präsentieren, was mich rund ums Klavier beschäftigt - zum Beispiel Reflexionen über Klaviertechnik, Szenen aus dem Unterricht, Beobachtungen zu einzelnen Musikstücken.

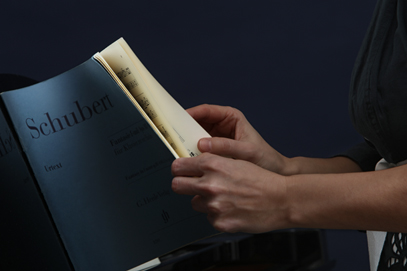
Auf dieser Seite möchte ich in lockerer Folge präsentieren, was mich rund ums Klavier beschäftigt - zum Beispiel Reflexionen über Klaviertechnik, Szenen aus dem Unterricht, Beobachtungen zu einzelnen Musikstücken.
Liszt und seine Etüde „Harmonies du Soir“
Liszt wird bereits seit vielen Jahren als Pianist gefeiert. Dann, 1831, geschieht für ihn etwas Umwerfendes: er erlebt in Paris Nicolo Paganini, den Teufelsgeiger. Liszt kommt auf die Idee, eine solche ins Fantastische gesteigerte Virtuosität auf das Klavier zu übertragen und sie in ein konstruktives Element seiner Musik zu verwandeln: Virtuosität soll Expression werden.
Es entsteht ein Zyklus, den er später Etudes d’exécution transcendante nennt. Transzendent will hier besagen: Etüden, deren Ausführung die Grenzen des bisher Vorstellbaren übersteigt.
Bei Harmonies du soir - Abendklänge - gibt Liszt (in der ersten Fassung) einen zusätzlichen Hinweis: Glocken heißt es dort. Die abendliche Klanglandschaft ist in diesem Anfang noch sehr transparent. Es beginnt mit tiefen Tönen, die langsam hin- und herpendeln. In der rechten Hand deutet sich eine Melodie an, aus der sich später das erste Thema bilden wird. Die zunächst sanft wogenden Akkordlinien bewegen sich in Tonfolgen, wie sie traditionell von Glocken gebildet werden (hier ist es die Folge h-g-h-d-e-d-h-g).
Manche dieser Glockenmelodien sind wiederum entstanden aus den Anfängen bekannter Kirchenlieder; ich höre in Liszts Glockenmelodie den Anklang des Chorals Wachet auf, ruft uns die Stimme. Als zweites Thema begegnet uns ein Gesangsrezitativ mit einer harfenähnlichen Begleitung. Beide Themen werden in großer Klangpracht wiederkehren; aufs kräftigste und apotheotisch verwandelt, in und über vibrierenden Akkorden. Dennoch wird es wieder ruhig, an diesem Abend.
Technische Essentials (I)
Die Haftung
Die Haftung gibt eine technische Basis für die Verbundenheit von Tönen. So wir die Taste nicht einfach nach unten drücken, sondern uns in sie „einhaken“ und sie in einer ziehenden oder schiebenden Bewegung zum Tastenboden führen, haften wir. In der Drehung des Spielapparats zur nächsten Taste zielen wir einen weiteren Haftpunkt am Tastengrund an. Wenn sich die Haftpunkte überlappen, entsteht Legato oder Legatissimo.
Die Haftung realisiert sich als Spannungsbogen zwischen zwei gelenkartigen Verbindungen: Finger-Taste und Hüfte-Sitzbank. Dieser Spannungsbogen zwischen dem Finger-Tasten-Gelenk und dem Hüft-Sitz-Gelenk ist unsere stabile und zugleich bewegliche Verbindung zum Klavier.
Johannes Brahms, „Guten Abend, gute Nacht“
Guten Abend, gute Nacht, ein Wiegenlied, das jeder kennt. Es ist gut einprägsam, obwohl nicht unbedingt einfach. Denn Brahms gelang bei dieser Komposition ein besonderer Kunstgriff: Er schrieb eine Melodie, und statt eine Begleitung zu komponieren, hat Brahms dafür ein ihm bekanntes Volkslied, einen Ländler genommen. Zwei Lieder, die zu einem wurden.
Es wurde so bekannt, dass es bald unzählige Bearbeitungen für alle möglichen Besetzungen gab. Das veranlasste Brahms zu einer sarkastischen Bemerkung seinem Verleger gegenüber: „Wie wär’s, wenn Sie vom ‚Wiegenlied’ auch Ausgaben in Moll machten, für unartige oder kränkelnde Kinder: Das wäre noch eine Möglichkeit, die Zahl der Ausgaben zu vermehren.“ Lena singt - das Original, für gesunde und artige Kinder. (Aus dem Schülerkonzert am 30.6. 2016 im Christophorus-Haus, Berlin)
Technische Essentials (II)
Mit Schirm, Charme und Orange
Milena spielt den Bauerntanz von Bartók. „Deine Bauern tanzen ein bisschen müde. Wo bleibt der Schwung? Was machen wir da?“ frage ich sie. Milena fällt ein, dass es letzte Woche besser ging, als sie die Hand wie ein Vogelnestchen geformt hat. „Oder stell dir vor, wie sich die Hand anfühlt, wenn du nach einer großen Orange greifst“, schlage ich ihr als weiteres Bild vor. „Oder wenn ich die Hand wie einen Regenschirm aufspanne“, meint Milena.
Mit so einer gut gespannten Hand kommen wir der Sache näher. Jetzt braucht es noch eine lebendige Vorstellung für den derben Tanz, den Bartók hier nachzeichnet. Ich erzähle, wie Bartók durch die Dörfer gezogen ist und die Musik aufgeschrieben hat, die er dort gehört hat; unser Stück auch, das wurde zu Hochzeiten gespielt und dazu wurde getanzt. Gemeinsam malen wir uns die Stimmung bei einem solchen Fest aus: Lautes Reden und Singen, und wie beim Tanz auf den Boden gestampft wurde – also braucht man dieses Stück auch nicht allzu zart anzugehen, wenn man die Bauern munter machen will.